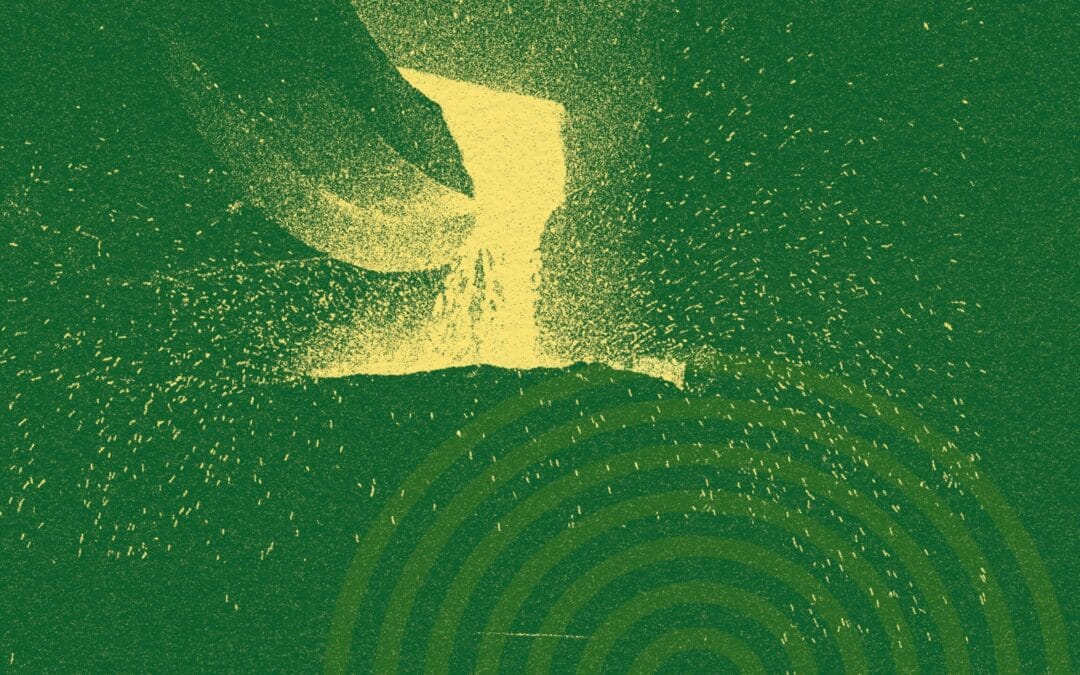Luise von communia bezieht sich in diesem Kommentar auf aktuelle Diskussionen in der Klimagerechtigkeitsbewegung. Der Text stellt die Meinung der Autorin dar.
„Braunkohle ist die Vergangenheit, Wasser ist die Zukunft“ – so fasste eine ältere Frau in Le Poitou während meines Besuchs des von die Aufstände der Erde organisierten „Dorfes des Wassers“ vor einem Jahr die Strategie der Klimabewegung in Frankreich zusammen. Damit brachte die Aktivistin zum Ausdruck, dass sich die französische Klimabewegung von den Ursachen der Krise abwendet und sich stattdessen den Folgen zuwendet. Angesichts von fortgeschrittener Klimakrise und notwendiger Klimaanpassung versucht die Bewegung, für die Allgemeinheit zu retten, was noch zu retten ist, und Verteilungskämpfe zu führen, bevor diese in Mitteleuropa existenziell werden.
Die französische Bewegung Soulèvement de la Terre (dt. Die Aufstände der Erde) hat es geschafft, Umweltschüter*innen, Klimaaktivist*innen, Kommunist*innen und Anarchist*innen rund um die Wasserfrage zusammenzubringen. In Deutschland gibt es seitdem Versuche, diese Dynamik aufzugreifen und eine Wasserbewegung aufzubauen. Den Anfang machten die Proteste rund um Tesla und die Wasserkonferenz bei Köln Anfang dieses Jahres. Aus Frankreich lässt sich lernen, wie die Frage der Wasserverteilung unterschiedliche Personengruppen zusammenbringt und dass sich auch heftige Auseinandersetzungen mit Musik und Spaß verbinden lassen. Aber auch die Kritik an der Intransparenz der Organisation der Aktionen sollte als Anregung mitgenommen werden.
Die Verteilungsfrage stellt sich materiell – Katastrophen treffen diejenigen härter, die über eine schlechtere Infrastruktur und ungenügende Versicherungen verfügen. Darüber hinaus kommt Wasser in der Klimakrise eine bedeutende Rolle zu: Wärmere Luft nimmt mehr Wasser auf, weshalb es häufiger zu Starkregen und Überschwemmungen kommt. Durch Dürren wird Wasser aber auch über längere Phasen als bisher zum knappen Gut. Deshalb ist die Wasserfrage so wichtig geworden.
Die Apokalypse und wir
Eine der Entwicklungsrichtungen, die zurzeit, beispielsweise auf der Wasserkonferenz bei Köln, diskutiert wird, ist eine zivile Katastrophenhilfe durch informelle aktivistische Strukturen, die im Zweifel jahrelang beispielsweise Opfer von Flutkatastrophen begleiten, weil Versicherungen und Staat nur ungenügend handeln. Diese Diskussion ist geprägt von der Annahme der heute stattfindenden Apokalypse, die insbesondere von der sogenannten Kollapsbewegung sowie dem Klimaaktivisten und Autor Tadzio Müller vertreten wird und die sich für ein „solidarisches Preppen“ einsetzen . Die Notwendigkeit von Katastrophenhilfe liegt auf der Hand, und daran lässt sich nichts kritisieren. Allerdings ist es ein Problem, aus direkter Nothilfe eine Strategie abzuleiten.
Müller geht sogar so weit, diese Form von Katastrophenhilfe als neue radikale Praxis auszurufen. Man könne gemäß dieser Logik nur noch kleine revolutionäre Momente in der Nische der Gesellschaft erfahren. Zum Beispiel, laut Müller, einen schwulen Moment auf einer Party in einer ansonsten autoritären Umgebung erleben. Oder eine gut funktionierende Küfa in einer zusammengebrochenen Nahrungsmittelkette. Aber nicht allen ist die Utopie genug, eine steile nicht barrierefreie Kellertreppe runterzusteigen und einen queeren Mann zu küssen. Manche kommen die Treppe ohne Hilfsmittel, die ein gutes Gesundheitssystem und umfangreichere Formen von Care-Arbeit voraussetzt, nicht hinunter. Eine queere Utopie am Rande der kollabierenden Gesellschaft außerhalb bestehender Versorgungsstrukturen kommt mir bei körperlicher Einschränkung und umfangreicheren Abhängigkeiten von materieller und immaterieller Care noch utopischer vor.
Was uns hingegen alle verbindet, ist, dass wir auf Versorgungssysteme angewiesen sind, egal ob Care, Wasser, Energieversorgung oder die energetische Sanierung der Wohnung für Hitzephasen. Bei allen besteht der gleiche Bedarf an Grundversorgung: Wohnen, Wärme, Wasser, Strom und Essen, die monatlich den Geldbeutel belasten.
Technisch komplexe Versorgungssysteme wie die der Wasserversorgung gestalten und ermöglichen unseren Alltag. Sie erfordern viel berufliche Expertise, Erfahrung und Wissen. Es braucht Infrastruktur und ihr Management, gerade in der Katastrophenhilfe. Aktivist*innen, die sich für die Vergesellschaftung der wichtigsten Sektoren der Grundversorgung einsetzen, berücksichtigen diese Aspekte bisher jedoch kaum. Noch weniger beschäftigen sie sich damit, wie diese weiterzuentwickeln sind. In der Anerkennung von nötiger technischer und logistischer Expertise liegt nichts Autoritäres. Die Frage ist, wie man damit umgeht und welche Implikationen diese ungleich verteilte Expertise für Verteilungsfragen hat.
Was folgt daraus? Preppen im Kontext der Klimakrise muss innerhalb bestehender (auch staatlicher) Versorgungsstrukturen stattfinden und darf nicht nur außerhalb in einer informellen Sphäre erfolgen. Andernfalls bleibt ohne gute Versorgung mit Wasser und Care nur noch Sozialdarwinismus übrig.
Wasser ist dabei das Gemeingut, das für die allermeisten ohne weitere Erklärung als solches verstanden wird. Preppen innerhalb der (staatlichen) Versorgungsstruktur, statt außerhalb dieser, bedeutet bei Wasser und Care, unbedingt Transparenz über vorhandene Hierarchien und Verteilungsmechanismen herzustellen und an den wichtigsten Bedarfen, also der Grundversorgung der Einzelnen anzusetzen. Und es bedeutet, für die Umsetzung (also beispielsweise gute kommunale Versorgungsstrukturen für alle), statt Aneignung der Umsetzung sozialer Rechte (also beispielsweise eine autonome Wasserversorgung) zu kämpfen. Natürlich ist Selbstversorgung immer wieder eine Notwendigkeit, wenn die Situation ist, wie sie ist. Aber das heißt eben nicht, sie zur absoluten Strategie umzuformulieren.
Es wäre naiv zu glauben, der Staat würde transparent und gerecht mit der Ressource Wasser umgehen. Er tut das nicht, sondern bevorzugt die großen Industrien. Deshalb muss es um die Demokratisierung des Zugangs zu den Grundwasserressourcen gehen. Und das heißt neben der radikalen Demokratisierung und Weiterentwicklung bestehender (staatlicher) Versorgungsstrukturen auch den Angriff auf die staatlichen Strukturen und Verwaltungen, die die Rechte an Grundwasser bisher auf Jahrzehnte an private Unternehmen vergeben. Es heißt Intransparenz, Privatisierung und Ungerechtigkeit anzugehen, statt sich an einzelnen politischen Regularien abzuarbeiten.
Das sollte umsonst sein
Der Fall Tesla in Brandenburg hat gezeigt, dass Kommunen auch zukünftig möglicherweise andere und umfangreichere Bedarfe an Grundwasser haben werden, die berücksichtigt werden müssen. Angesichts von Knappheit und Dürren benötigt auch die Landwirtschaft mehr Wasser. Bei diesen Kalkulationen muss nicht nur den Landesregierungen auf die Finger geschaut werden, sondern Verteilungsfragen müssen auch grundsätzlich demokratisiert werden.
Für mehr Organisierung für die eigenen sozialen Rechte ist die Prämisse entscheidend, dass Grundversorgung umsonst verfügbar sein sollte und alles andere als Diebstahl an den eigenen Rechten betrachtet werden kann. Wasser und Care zu benötigen ist keine Strategieentscheidung. Sobald eines davon nicht in dem Ausmaß zur Verfügung steht, in dem man es subjektiv benötigt, wird die eigene Verletzlichkeit umfassend erlebbar. Wasser und Care zu verknüpfen, bedeutet in erster Linie, das Bewusstsein für die eigenen grundlegenden sozialen Rechte zu schärfen. Es geht darum, vor Augen zu führen, wie es auch sein könnte. Wasser in guter Qualität und in ausreichender Menge kostenlos verfügbar zu haben. In diesem Sinne ist Wasser ähnlich wie Care: Es ist so essenziell, dass sowohl informelle als auch formelle Strukturen ununterbrochen und nebeneinander existierend gestärkt und sichtbar gemacht werden müssen. Das ist wahres Krisenprepping.
Möglichkeiten, die Wasserfrage zu politisieren und aktiv zu werden, bestehen auf allen Ebenen: Wir können Rekommunalisierungsbewegungen (wie in Berlin) unterstützen und radikalisieren, indem wir die Themen Transparenz der Institutionen und Demokratisierung stark machen. Auf Landesebene muss Druck gegen die seit Jahrzehnten gängige Vergabepraxis von Grundwasser und anderen Wassernutzungsrechten aufgebaut werden. Diese haben letztlich Auswirkungen auf die Planung der Kommunen, die es mitzugestalten gilt. Auf Bundesebene muss die Priorität der Daseinsvorsorge gestärkt werden und international die ungleiche Verteilung von Trinkwasser als politische Verteilungsfrage statt als Frage von Entwicklungshilfe adressiert werden. Bezogen auf den Care Sektor lassen sich dieselben Ebenen durchdeklinieren, mit dem Ziel unbezahlte und bezahlte Care Arbeit aufzuwerten. Care und Wasser zeigen auch wie gut autonome so genannte präfigurative Strategien mit technisch komplexer und notwendiger – weil überlebenswichtiger – öffentlicher Versorgung zusammenkommen können. The more the merrier.