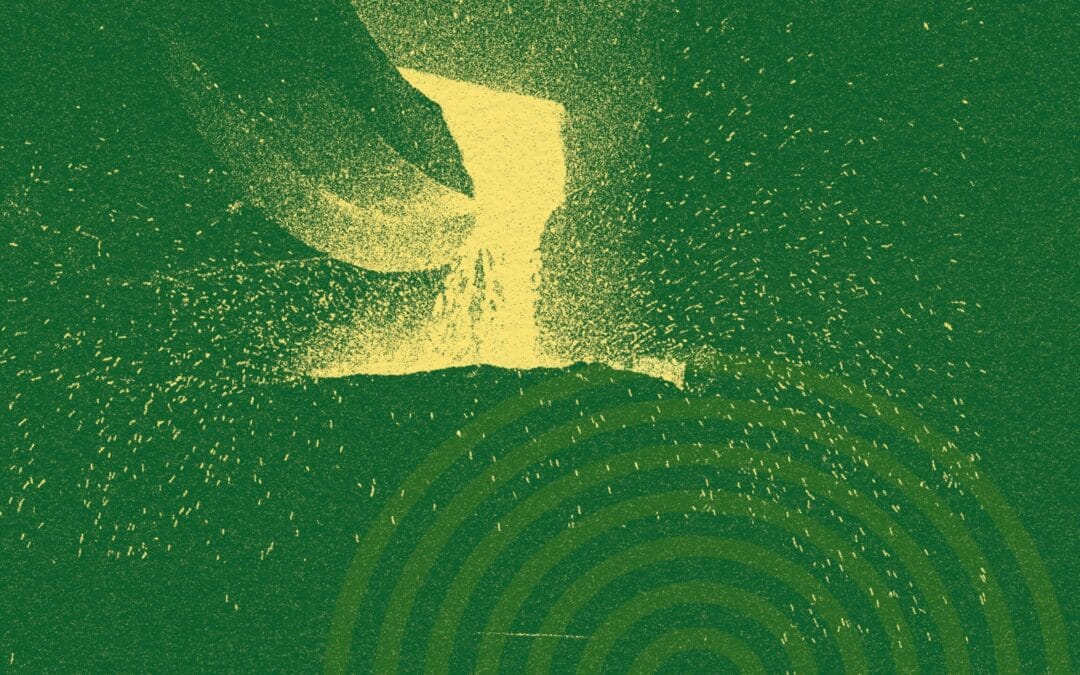Der folgende Text ist der zweite Teil zu Öffentlichem Luxus und Grundversorgung, den Phil Jones am 31. April 2025 für das Autonomy Institute geschrieben hat. Vincent hat den Text für unseren Blog übersetzt. Der Text stellt ausschließlich die Meinung des Autors dar.
Einführung
Helen Hester und Nick Srnicek haben am meisten dazu beigetragen, eine klare Vorstellung davon zu vermitteln, was „Öffentlicher Luxus“ bedeuten könnte, wenn das Konzept über eine bloße Wiederbelebung des öffentlichen Sektors hinaus geht. In ihrem Buch „After Work“ beschreiben sie folgende Elemente dieser Vision: 1) „infrastrukturelle Extravaganz“ wie prächtige Parks, Museen und Bibliotheken, die allen zur Verfügung stehen; 2) „die Sozialisierung einiger häuslicher Reproduktionsarbeiten“ wie das Kochen und Putzen und die Kindererziehung in gemeinsamen Einrichtungen; 3) der „gemeinschaftliche Besitz von Werkzeugen“ – insbesondere von teuren Geräten wie beispielsweise von automatischen Staubsaugern.
Hester und Srnicek konzentrieren sich vor allem auf den städtischen und häuslichen Raum, aber der Begriff „Öffentliche Luxus“ kann sich ebenso auf viele immaterielle Elemente des öffentlichen Raums beziehen. Es gibt etliche weitere wichtige Kategorien, die ihrer Typologie hinzugefügt werden könnten, aber in diesem Text wollen wir uns auf die Folgenden konzentrieren: 4) „Ästhetischer Reichtum“, die Bereicherung und Erweiterung von Sinneserfahrungen; und 5) „Epistemische Freiheit“, die Ressourcen zum Denken, Interpretieren und zum Lesen und Schreiben über die Welt.
In der folgenden Darstellung werden die Kategorien von Hester und Srnicek erweitert und leicht angepasst. Zudem wird „ästhetische Fülle“ und „epistemische Freiheit“ genauer angeschaut, um ein klareres Bild davon zu zeichnen, wie öffentlicher Luxus in der Praxis aussieht.
- Infrastrukturelle Extravaganz
Infrastrukturelle Extravaganz bedeutet große und reichhaltige öffentliche Räume, die ebenso einladend und großzügig wie beeindruckend sind.
Sie verkörpern Neugierde und Komfort gleichermaßen. Zu diesen Räumen können attraktive Parks, prächtige Bahnhöfe und elegante Sozialwohnungen gehören. Ein Beispiel für Letzteres ist die Architektur der Smithsons in den fünfziger und sechziger Jahren. Owen Hatherley beschreibt in Militant Modernism: „Es wäre dicht, es wäre urban, und während es unverblümt die Armen beherbergen und Teil des neuen Wohlfahrtsstaates sein würde, wäre es zugleich glamourös.“
Robin Hood Gardens, ein inzwischen international anerkanntes Beispiel für brutalistische Architektur, ist ein Anwärter auf die beste Umsetzung des „öffentlichen Chic‘s“ durch die Smithsons. Der riesige Betonmonolith, gedacht als schamlos futuristische Anlage mit ‚Straßen im Himmel‘, sollte so dramatisch und unübersehbar wirken wie ein Aquädukt. Obwohl die Anlage heute etwas verfallen und trostlos wirkt, wurde sie ursprünglich mit der Absicht errichtet, den sozialen Wohnungsbau zur ästhetischen Avantgarde des Städtebaus zu machen. Im Inneren sind die Wohnungen geräumig und vermitteln ein Gefühl von gemütlicher Privatsphäre. Aber das Gebäude selbst, das aus Hunderten von dicht gedrängten Wohnungen besteht, sollte eine öffentliche Kultur der Geselligkeit und Nachbarschaftspflege schaffen.
Als Soziale Kondensatoren können solche Räume mehrere soziale Funktionen haben: z. B. Wohnungen, Arbeitsräume, Kantinen und Gärten miteinander zu verbinden. Ein offensichtliches Beispiel ist das Barbican, ein Gebäude, dessen ineinandergreifende Schichten von Wohnungen, Gehwegen, Cafés, Pubs und verschiedenen anderen sozialen Einrichtungen immer wieder für Überraschung und Neugierde sorgen. Nach den Worten eines Architekten aus dem 20. Jahrhundert sollte der Komplex „bestimmte Merkmale aufweisen, die den Übergang zu einer sozial höherwertigen Lebensweise stimulieren – stimulieren, aber nicht diktieren“. Es geht dabei nicht darum, viele verschiedene Arten von sozialen Einrichtungen aus Effizienzgründen zusammenzupacken – wie zum Beispiel bei dem im Neoliberalismus so beliebte Konzept von „mixed use development“ – sondern vielmehr darum, neue Arten des kollektiven Lebens zu fördern, indem vielfältige soziale Bedürfnisse auf neuartige Weise erfüllt werden.
- Sozialisierung von Reproduktionsarbeit
Im „Roten Wien“ begann die sozialdemokratische Stadtverwaltung nach dem Ersten Weltkrieg, in großem Stil architektonisch ambitionierte Wohnanlagen zu errichten. Sie sollten nicht nur Wohnraum schaffen, sondern ganz bewusst das häusliche Leben neu gestalten. Die Anlagen boten weit mehr als bloße Wohnungen: Gesundheitseinrichtungen, Wäschereien, Kindergärten, Turnhallen, Hörsäle, Werkstätten, Gärten und Bibliotheken gehörten selbstverständlich dazu. Auf diese Weise sollte die Last der häuslichen Arbeit, die überwiegend von Frauen getragen wurde, spürbar verringert werden (Hester und Srnicek). Es war zugleich ein Versuch, das rückgängig zu machen, was die Theoretikerin Kathi Weeks als „Privatisierung der Pflege“ bezeichnet.
„Die enorme Menge an Zeit, Fähigkeiten und Energie, die für die Betreuung von Kindern, älteren Menschen, Kranken und Behinderten, die Selbstfürsorge und die Pflege der Gemeinschaft aufgewendet wird und ohne die das Wirtschaftssystem nicht existieren würde, wird in den Momenten, die außerhalb der einkommensschaffenden Arbeit verbleiben, zumeist unentgeltlich und in unverhältnismäßig hohem Maße von Frauen erbracht“.
Im Wiener sozialen Wohnungsbau verzichtete man auf Gemeinschaftsküchen – ein Konzept, das jedoch in vielen experimentellen Architekturen der Moderne, von der Sowjetunion bis ins New York der frühen zwanziger Jahre, verbreitet war. Hinter solchen Versuchen stand die Idee eines „küchenlosen“ Wohnens. Hester und Srnicek betonen, dass private Küchen nicht nur bestehende Geschlechterungleichheiten zementieren, sondern auch ökologisch problematisch sind: Wenn jede Familie für sich kocht, entstehen meist erhebliche Mengen an Lebensmittelabfällen.
Wie bereits im letzte Blogbeitrag dieser Reihe gezeigt, gab es in Europa wie auch weltweit erfolgreiche und dauerhafte Experimente mit gemeinschaftlichem Essen – vom britischen Restaurantprogramm während des Krieges bis hin zu Mexikos aktuellem Social Kitchen-Programm. Wenn wir diese Beispiele weiterspinnen, lässt sich eine häusliche Welt erahnen, die nach dem Prinzip des „öffentlichen Luxus“ gestaltet ist: eine Welt, in der jede Gemeinschaft Zugang zu kostenlosen oder erschwinglichen Restaurants, Gemeinschaftsküchen, Vorratskammern und einladenden Essplätzen hat.
Der Sinn gemeinschaftlichen Kochens besteht nicht darin, die private Küche ganz abzuschaffen – schließlich empfinden viele Menschen das Kochen als etwas Schönes und Bereicherndes. Vielmehr geht es darum, unterschiedliche Möglichkeiten zu eröffnen und die Dominanz der privaten Küche aufzubrechen. Wer nicht selbst kochen möchte, könnte stattdessen ein Gemeinschaftsrestaurant besuchen oder die Kochaufgaben in einer gemeinsam genutzten Küche mit anderen teilen.
Ambitionierter ist die Vorstellung eines Systems, in dem Fürsorge nicht mehr privatisiert ist und nicht mehr ausschließlich zu Hause stattfindet. Öffentlicher Luxus bedeutet eine Gesellschaft, in der Fürsorge nicht knapp, sondern im Überfluss vorhanden ist. Dies würde bedeuten, dass jede Gemeinde Zugang zu „long term care centres“, ausreichender und erschwinglicher Kinderbetreuung sowie zu Diensten mentaler Gesundheit einschließlich erschwinglicher Psychotherapie hat.
- Gemeinschaftseigentum an Gütern
Öffentlicher Luxus bedeutet auch, unseren Blick auf Alltags- und Haushaltsgegenstände zu verändern. In den letzten Jahren hat sich das Ausleihen statt Kaufen für viele Haushalte in schwieriger Lage als Möglichkeit erwiesen, Geld zu sparen. Im ganzen Vereinigten Königreich entstehen „Bibliotheken der Dinge“: Orte, an denen Nachbarschaften ganz alltägliche Gegenstände wie Bohrmaschinen oder Industriereiniger, aber auch Filmprojektoren, Beschallungsanlagen oder Lautsprecher ausleihen können – Dinge also, die man nur gelegentlich braucht, die im Einzelnen aber teuer sind. Man könnte dieses Phänomen schlicht als Antwort auf Sparpolitik und steigende Lebenshaltungskosten sehen. Doch es birgt auch den Keim einer anderen Zukunft – einer Welt jenseits des unhaltbaren Modells des Privateigentums.
Anders als in einigen europäischen Ländern werden solche Initiativen in Großbritannien nicht von der öffentlichen Hand getragen. Stattdessen haben soziale Unternehmen wie die „Bibliothek der Dinge“ die Lücke gefüllt, die durch den Rückzug staatlicher Versorgung entstanden ist. Zwar handelt es sich dabei um private Anbieter, die ihre Gegenstände gegen eine geringe Gebühr an Mitglieder vermieten, doch eröffnen sie zugleich eine Perspektive auf eine Form des öffentlichen Luxus: den Zugang für alle zu zeitgemäßen, erschwinglichen und gut gemachten Produkten. Sie weisen auf eine Zukunft hin, in der Nutzung wichtiger ist als exklusiver Besitz.
Es geht dabei nicht darum, Menschen den Besitz von Dingen zu verbieten, sondern vielmehr den Zwang zu individuellem Konsum zu verringern. Viele Gegenstände, die wir nur selten verwenden, lassen sich sinnvoller in gemeinschaftlicher Nutzung organisieren, anstatt in privaten Haushalten ungenutzt herumzustehen. Solche Dinge könnten in jeder Nachbarschaft über eine öffentlich geführte „Bibliothek der Dinge“ zugänglich gemacht werden. Die Bandbreite reicht von Staubsaugern, Druckern und Küchengeräten über Nähmaschinen, Musikinstrumente, Fahrräder und Heimwerker- sowie Gartengeräte bis hin zu Ausstattung für Kleinkinder wie Wickelkommoden, Kinderwagen oder Kleidung.
Dass all diese Gegenstände bereits heute über Sozialunternehmen oder kommerzielle Anbieter ausgeliehen werden können, zeigt, dass es eine erhebliche Nachfrage nach solchen Diensten gibt. Doch statt privatwirtschaftlich organisiert zu sein, sollten diese Angebote in öffentlicher Hand liegen und von den Gemeinden betrieben werden – lokal verankert, bedarfsgerecht und kostenfrei am Ort des Zugangs.
- Ästhetischer Reichtum
Ästhetischer Reichtum bedeutet im einfachsten Sinne, dass ästhetische Erfahrungen im Zentrum des gesellschaftlichen Lebens stehen – dass unsere Umgebung so gestaltet ist, dass sie die Sinne anregt, neue Ideen hervorbringt, Gefühle weckt und körperliche Erfahrungen ermöglicht. Es ist die Vorstellung, dass soziale Räume und Institutionen dazu beitragen, kollektive Freude, intensive Neugier oder sogar produktive Verwirrung zu erzeugen. Kunstgalerien, Musikveranstaltungen, Theater, Museen oder kommunale Kunstzentren eröffnen uns die Möglichkeit, inmitten anderer Menschen schöne, seltsame und unerwartete Sinneserfahrungen zu machen.
Am Ende des 20. Jahrhunderts veränderte der Neoliberalismus die Rolle der Kultur: Statt als kollektiver Prozess der Sinnstiftung galt sie nun als Konsummarkt für individuelle Unternehmer:innen und selbstbezogene Vergnügungssüchtige. Aus dieser „Kreativindustrie“ entwickelte sich die hyperindividualisierte Welt der Apps und Content-Plattformen, in der Netflix Kino und Theater ersetzt, YouTube die Konzertbühnen, Online-Kunstmärkte Galerien überflüssig machen und Spotify den Lebensunterhalt von Musiker:innen aushöhlt.
So verschwinden Kinos, Kunstgalerien und Konzertorte zunehmend aus der Kulturlandschaft. In der Welt der individualisierten Inhalte anstelle kollektiver Kulturproduktion begegnen wir KI-generierten Musiker:innen auf Spotify, Netflix-Megaflops oder einem „Luftraum“, wie man das algorithmisch erzeugte Gefühl der Ortlosigkeit nennen könnte, das sich in der standardisierten Dekoration von Cafés, Shops und Wohnungen rund um den Globus zeigt. Kultur wird hier zur Betäubung – nicht zur ästhetischen Erfahrung.
Doch wir müssen nicht weit zurückblicken, um eine andere Vision ästhetischen Lebens zu finden. Ästhetische Fülle ist kein Hirngespinst, sondern war ein zentraler Bestandteil der verlorenen Utopien des 19. und 20. Jahrhunderts. Kristin Ross beschreibt, wie die Pariser Kommune so organisiert war, dass ästhetische Erfahrung zu einem Kern des gesellschaftlichen Lebens wurde: Kunst und Schönheit standen allen offen, nicht nur einer privilegierten Minderheit. Mark Fisher wiederum weist in seiner Analyse der Gegenkultur der 1960er Jahre darauf hin, dass eine „beispiellose Ästhetisierung des Alltagslebens“ die gesamte soziale Realität durchdrang. Orte wie Haight Ashbury oder Drop City lassen sich als Kapsel-Utopien begreifen – Gemeinschaften, in denen jeder die Zeit hatte, sich künstlerisch zu entfalten.
Der Kulturtheoretiker Justin O’Connor beschreibt diese Form von Luxus als „Lux“ – die Erleuchtung des menschlichen kreativen Potenzials. Es geht dabei nicht um Konsum als Selbstzweck, sondern um den Genuss, die vielen Möglichkeiten künstlerischer Produktion und Teilhabe zu erkunden. Diese Phantasie darf sich nicht auf traditionelle Institutionen beschränken, sondern sollte auch gescheiterte, aber inspirierende Experimente kollektiver Kunstproduktion einbeziehen.
Ein faszinierendes Beispiel ist Joan Littlewoods Fun Palace. Angeregt von den neuen Campus-Universitäten der 1960er Jahre, wollte Littlewood die Kultur im ganzen Vereinigten Königreich für alle zugänglich machen. Ihre Idee war ehrgeizig und offen zugleich: ein Raum, der Kunst, Wissenschaft und Unterhaltung vereint – frei zugänglich und für jede und jeden.
In Littlewoods eigenen Worten: „Wählen Sie, was Sie tun möchten – oder schauen Sie jemandem dabei zu. Lernen Sie den Umgang mit Werkzeugen, Farben, Babys oder Maschinen, oder hören Sie einfach Ihre Lieblingsmusik. Tanzen Sie, reden Sie, oder lassen Sie sich emporheben, um zu sehen, wie andere Dinge tun. Setzen Sie sich mit einem Getränk in die Weite des Raumes und lauschen Sie, was anderswo in der Stadt passiert. Versuchen Sie, einen Aufstand anzuzetteln oder ein Bild zu beginnen – oder lehnen Sie sich zurück und starren Sie in den Himmel.“
- Epistemische Freiheit
Mit dem Bildungsgesetz von 1962 wurde im Vereinigten Königreich festgelegt, dass die Studiengebühren für die Hochschulbildung von den lokalen Behörden übernommen werden. Diese Politik galt unabhängig von Alter oder sozialem Hintergrund und öffnete die Türen der Hochschulen für weite Teile der Bevölkerung. Plötzlich erhielt eine viel größere Gruppe von Menschen die kollektive Fähigkeit, die Welt zu deuten, zu lesen, zu schreiben und kritisch zu denken.
Diese Form des öffentlichen Luxus lässt sich als epistemische Freiheit bezeichnen – ein Begriff, der die Institutionen und Ressourcen beschreibt, die das gemeinsame Wissen einer Gesellschaft erweitern, die Freude am Lernen fördern und Menschen die Möglichkeit geben, über ihre Rolle in der Welt nachzudenken. Gemeint sind damit nicht nur intellektuelle Erfahrungen, sondern auch praktische: das Erlernen neuer Fähigkeiten, die nicht zwingend auf den Arbeitsmarkt ausgerichtet sind, sondern um ihrer selbst willen Freude bereiten – wie das Nähen, das Spielen eines Instruments oder das Erlernen eines Handwerks. In diesem Sinne bedeutet epistemische Freiheit auch Beweglichkeit: die Freiheit, mit möglichst wenigen Barrieren zwischen Berufen, Interessen und Tätigkeiten zu wechseln.
Solche Freiheiten entstehen durch öffentliche Güter wie Bibliotheken, Museen, Archive, Wikipedia, kostenloses Breitband oder gemeinschaftliche Veranstaltungen. Doch der private Markt verknappt genau diese Ressourcen. Unter dem Einfluss neoliberaler Politik haben aufeinanderfolgende Regierungen in Großbritannien Bibliotheken, Museen – und die Bildung im weiteren Sinne – in Waren verwandelt, die für viele nicht mehr zugänglich sind. Epistemische Freiheit bedeutet daher, diese künstliche Knappheit zu überwinden und den Zugang für alle wieder zu öffnen.
Gleichzeitig geht es darum, eine fantasievollere, nachhaltigere und gemeinschaftlichere Vision des öffentlichen Lernens zu entwickeln. Europas ehrgeizige Bibliotheksprojekte – etwa die Oodi-Bibliothek in Helsinki oder die De-Krook-Bibliothek in Gent – sind Beispiele dafür, wie sich epistemische Freiheit konkret verwirklichen lässt. Neben riesigen Sammlungen an Büchern und Lesematerial bieten sie Radiostudios, Musikräume, Makerspaces mit Lasercuttern, 3D-Druckern, Nähmaschinen und Lötstationen sowie kostenlose Beratungsangebote für Rechtsfragen und Erwachsenenbildung.
Im nächsten Blogbeitrag werden wir genauer darauf eingehen, wie Bibliotheken diese Form von Freiheit verkörpern und welche Bedeutung sie für eine demokratische und kreative Gesellschaft haben.