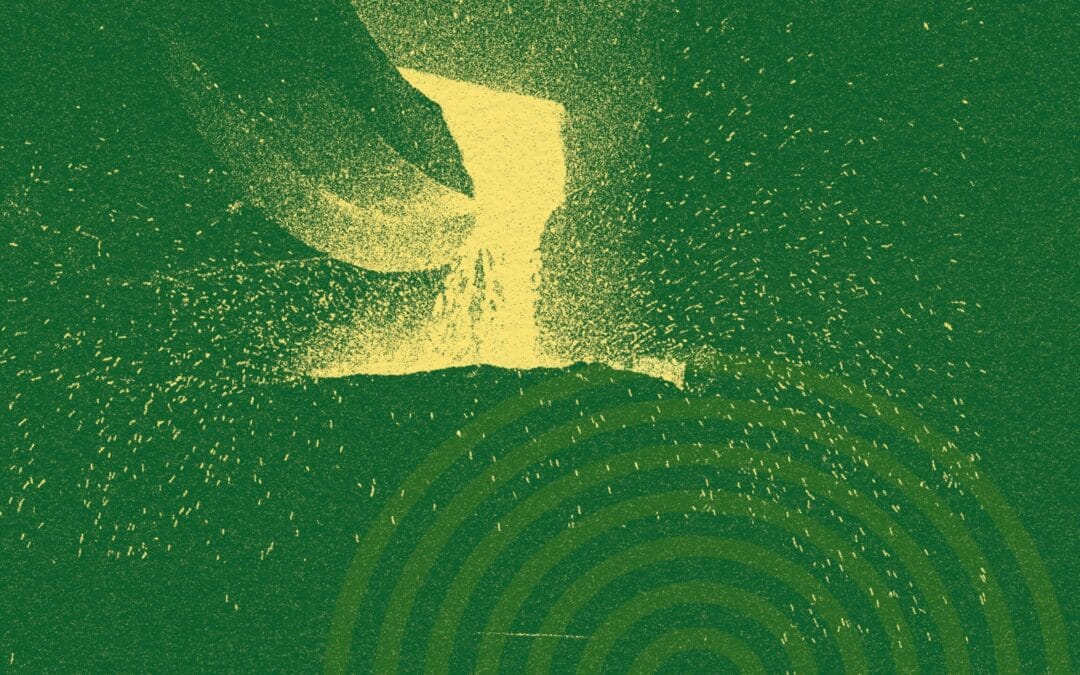Dieser Beitrag von Andrea von communia erschien zuerst in der Philosophie-Zeitschrift Agora42.
Gemeineigentum als materielle Grundlage von Hoffnung
Wachstum galt in unserer Gesellschaft lange als Versprechen für Wohlstand und ein gutes Leben – doch dieses Versprechen hat sich für die meisten als Trugschluss entpuppt. Statt Sicherheit und Teilhabe bringt die auf Privateigentum und Konkurrenz basierende Marktwirtschaft zunehmend soziale Spaltung, ökologische Krisen und Hoffnungslosigkeit hervor. Die Mehrheit arbeitet für einen gesellschaftlichen Reichtum, der von wenigen angeeignet und vielen vorenthalten wird. Öffentlicher Luxus setzt hier an, indem Wohlstand neu gedacht wird: als kollektiver Zugang zu Lebensqualität statt privater Anhäufung.
Wirtschaftswachstum galt lange Zeit als eines der zentralen Hoffnungsmotive der Moderne. Es versprach Fortschritt, Wohlstand und Teilhabe für alle – und war damit eng an demokratische Ideale geknüpft. Dieses Versprechen erweist sich bereits“seit Jahrzehnten als Trugschluss und hat sich heute an vielen Stellen in sein Gegenteil verkehrt: Statt sozialer Sicherheit bringt wachstumsorientiertes Wirtschaften ökologische Krisen, Armut, Vertreibung, Kriege und globale Ungleichheit hervor. Das, was lange als Lösung galt, ist nachweislich das Problem. Denn anders als oft behauptet, führt ökonomisches Wachstum in privatwirtschaftlichen Marktwirtschaften nicht durch „unsichtbare Hände“ zu gesellschaftlichem Wohlstand, sondern vorrangig zum Wohlstand derer, die sich den gesellschaftlich erarbeiteten Wohlstand privat aneignen dürfen.
In kapitalistischen Gesellschaften sind das die Privateigentümer*innen an den Produktionsmitteln, die Aktionär*innen und Shareholder. Wachstum ist dabei kein rein lukrativer Mechanismus zur Gewinnmaximierung, sondern eine strukturelle Notwendigkeit von Privateigentum. Nur durch die fortlaufende Verwertung von Kapital kann es erhalten und vermehrt werden, weshalb immer mehr produziert werden muss. Stillstand bedeutet nicht Konstanz, sondern Gefahr. Kein Wachstum heißt: Verlust, Krise, Insolvenz. Im Kern des Wachstums herrschen daher Konkurrenzdruck und Angst. Ausbeutung und Umweltzerstörung sind ihm strukturell eingeschrieben. Die gesellschaftlichen Konsequenzen: soziale Spaltung, Isolation, Perspektivlosigkeit – und ein Nährboden für autoritäre Antworten inmitten wachsender Hoffnungslosigkeit.
Potenziale in den Krisen erkennen
Die zentrale Voraussetzung für das zerstörerische Wachstum ist das Privateigentum an Produktionsmitteln. Zum einen ist es die Grundlage für die kontinuierliche Kapitalvermehrung, die für den Erhalt des Wirtschaftswachstums unabdingbar ist, zum anderen bedeutet es, dass der Großteil der Bevölkerung von den Entscheidungs-, Verfügungs und Nutzungsrechten ausgeschlossen wird. Privateigentum definiert also nicht nur, wer sich die Gewinne aneignen darf, sondern auch, wer Produktions und Investitionsentscheidungen treffen und über die produzierten Güter verfügen darf. Darin liegt der zentrale Widerspruch der kapitalistischen Produktionsweise: Gesellschaftlicher Reichtum ist längst vorhanden – er wird von unzähligen Menschen tagtäglich erarbeitet – doch er ist, global gesehen, den meisten Menschen nicht zugänglich. Selbst in den westlichen Ländern, die ja massiv auf Kosten des globalen Südens und auf Kosten einer intakten Umwelt wirtschaften und leben, kommt er immer weniger Menschen zugute. Er wird privat angeeignet und die Allgemeinheit wird von wichtigen Entscheidungen ausgeschlossen – mitunter von der Entscheidung, was und wieviel eigentlich produziert werden soll. In privatwirtschaftlichen, das heißt auf Privateigentum basierenden Marktwirtschaften wird die Produktion nicht an gesellschaftlichen Bedürfnissen orientiert, sondern vorrangig an der Gewinnmaximierung. Da die Produktion dezentral über Märkte koordiniert wird und aufgrund des Wachstumszwangs ständig Konkurrenzsituationen entstehen, werden zudem gesellschaftliche und zwischenbetriebliche Absprachen und Aushandlungen über Produktionsbedarfe unterbunden. Dies trägt zusätzlich dazu bei, dass entweder zu viel oder aber zu wenig produziert wird. Außerdem muss die über das Privateigentum definierte exklusive Verfügungsmacht konstant abgesichert werden, sei es in Form von strengen Kontrollen von Nutzungsrechten oder in Form von Gewalt und Freiheitsentzug.
Der Widerspruch besteht also darin, dass aufgrund der Produktionsmöglichkeiten gesellschaftlicher Wohlstand zwar vorhanden bzw. möglich ist, die Eigentumsverhältnisse diesem aber strukturell entgegenwirken. Doch gerade in den Widersprüchen des Bestehenden liegt das Potenzial zu seiner Veränderung. Im Sinne Ernst Blochs ist Ho!nung weder illusionäre Utopie noch naiver Optimismus, sondern eine antizipierende Bewusstseinsform: Sie greift voraus auf das Noch-Nicht-Seiende, das im Jetzt bereits angelegt ist. So verstanden offenbart sich inmitten der Krisen nicht nur das Scheitern des Alten, sondern auch das Potenzial des Neuen – Hoffnung als konkrete Möglichkeit einer anderen Zukunft.
Worin besteht dieses Potenzial? Im Kapitalismus ist Luxus nicht öffentlich zugänglich, sondern wird privat angeeignet. Neben dieser Ungleichverteilung, die auf der Enteignung der Gemeinschaft mittels Privatisierung (privare = entreißen, rauben) basiert, nimmt Luxus in kapitalistischen Gesellschaften zudem obszöne und verschwenderische Formen an. Damit sind nicht nur Luxusgüter mit schlechter CO2-Bilanz gemeint, wie beheizte Pools, Luxusyachten und Privatjets. Auch volkswirtschaftlich leisten wir uns eine verschwenderische Form von „Luxus“: Wir stecken immense Produktivkräfte – menschliche Arbeit ebenso wie natürliche Ressourcen – in die Herstellung von Gütern, die keinen sozialen Nutzen stiften. Sei es, weil sie allein der Gewinnmaximierung dienen und keinen echten Gebrauchswert haben, weil sie am Bedarf vorbei im Überfluss produziert wurden oder weil sie einzig dazu da sind, Menschen vom Zugang zu Grundbedürfnissen auszuschließen – wie beispielsweise Fahrkartenautomaten oder Gefängnisinfrastrukturen für die mehreren Tausend Menschen, die in Deutschland jährlich wegen Fahrens ohne gültigen Fahrschein Freiheitsstrafen verbüßen müssen.
Öffentlicher statt privater Luxus
Statt privatem und privatwirtschaftlichem Luxus brauchen wir „öffentlichen Luxus“ für ein gutes Leben für alle. Genau hier liegt das transformative Potenzial zur produktiven Wendung des Widerspruchs. Durch Vergesellschaftung – also die Überführung von Privateigentum in demokratisch kontrolliertes, am Gemeinwohl ausgerichtetes Gemeineigentum – lässt sich demokratische Kontrolle über das Gemeinsame wiederherstellen und die gewinnorientierte Marktlogik in die Schranken weisen. Die Eigentumsfrage wird zur Hoffnungsperspektive (siehe hierzu auch das Buch Öffentlicher Luxus; Karl Dietz, 2023). Öffentlicher Luxus beschreibt einen kollektiven Wohlstand, der nicht auf individuellem Reichtum und Wachstum beruht, sondern auf allgemeinem und bedingungslosem Zugang zu hochwertiger Infrastruktur, auf mehr frei verfügbarer Zeit und auf einer insgesamt höheren Lebensqualität. Er meint keine exklusive Extravaganz für wenige, sondern geteilte Fülle für alle: etwa kostenfreie Mobilität, gute Gesundheitsversorgung, hochwertige Bildungsangebote und kulturelle Teilhabe. Im Unterschied zu Konzepten wie den Universal Basic Services, die in erster Linie Grundbedürfnisse abdecken, zielt ö!entlicher Luxus also nicht nur auf das Minimum, sondern auf ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben auf Grundlage gemeinsam verwalteten Gemeineigentums. Gerade im Kontext von Degrowth (Postwachstum) zeigt öffentlicher Luxus seine transformative Kraft: Er macht aus dem ökologisch notwendigen Rückbau keine Verzichtserzählung, sondern eine kollektive Aufwertung des Gemeinsamen. Während private Konsumsphären schrumpfen, wachsen öffentliche Räume der Teilhabe, Qualität, Sicherheit und Solidarität.
Statt auf Wachstum durch private Akkumulation setzt öffentlicher Luxus auf Umverteilung durch Vergesellschaftung. Vergesellschaftung bewirkt jedoch nicht nur eine sinnvollere Verteilung von gesellschaftlichem Wohlstand, sondern führt auch zur Verringerung der Überproduktion sowie zur Verbesserung der Qualität dessen, was produziert wird. Mithilfe am Gemeinwohl orientierter, demokratischer (Selbst-)verwaltung ersetzt sie die isolierte, spekulative, konkurrenz und profitgetriebene Koordination der Produktion über Märkte durch eine bedürfnisorientierte, (umwelt-) bewusste und gemeinschaftliche Koordination, die eine nachhaltigere und effizientere Nutzung von Ressourcen ermöglicht – und damit eine Wirtschaft, die uns allen dient.
Dies ist jedoch keineswegs ein Selbstläufer. Öffentlicher Luxus ist keine fertige Lösung, sondern schafft „nur“ die strukturellen Voraussetzungen für eine Wirtschaft, die allen zugutekommt. Er ersetzt private Akkumulation durch kollektive Verfügung, Konkurrenz durch Solidarität und Ausschluss durch Teilhabe. Doch klar ist auch: Seine Verwirklichung erfordert Auseinandersetzung, demokratische Kämpfe und gesellschaftliche Organisierung. Denn eine Wirtschaft, die nicht wenigen nützt, sondern allen, muss auch von vielen gestaltet und gemeinsam immer wieder neu ausgehandelt werden, besonders vor dem Hintergrund knapper werdender Ressourcen und und globaler Verteilungsfragen.
Transformationsperspektiven
Die Veränderung der Eigentumsform ist dabei der zentrale Anknüpfungspunkt für konkret umsetzbare Veränderungen im Hier und Jetzt. Sie ist kein fernes Ziel, sondern beginnt bereits dort, wo Vergesellschaftungsinitiativen – etwa im Wohnungs- oder Energiesektor – unter Berufung auf Artikel 15 des Grundgesetzes vergesellschaftete Eigentumsalternativen einfordern. Auch in alltäglichen Kämpfen für (Klima-) Gerechtigkeit, in basisdemokratischen Organisationsformen und solidarischen Praktiken wird heute schon vorweggenommen, was morgen als gesellschaftliche Struktur Wirklichkeit werden kann. Denn wir werden nicht von heute auf morgen die (selbst-)zerstörerischen, konkurrenzbasierten Verhaltensweisen ablegen und miteinander solidarisch sein können. Dafür braucht es Räume und Gelegenheiten, um diese veränderten Beziehungsweisen sowohl zueinander wie auch zur nichtmenschlichen Umwelt zu erproben und zu erlernen. Dazu gehört auch, gemeinsam zu lernen, wie mit Konflikten umgegangen werden kann: Konstruktive Auseinandersetzungen und demokratische Streitkultur sind grundlegende Bestandteile einer gemeinsam zu gestaltenden Ökonomie und können Resignation, Isolation und psychischen Erkrankungen entgegenwirken. Deshalb ist es wichtig, das Augenmerk auf diejenigen Praktiken, Orte und Organisationsformen zu richten, die solche Ansätze bereits heute antizipieren, und diese auszuweiten.
So gesehen ist Öffentlicher Luxus kein abgehobenes Konzept, in dem die Hoffnung abstrakt bleibt, sondern speist sich aus den konkreten Widersprüchen, Notwendigkeiten und Potenzialen der Gegenwart. Es ist kein Wundermittel für jedes Problem, sondern ein Denkansatz, der die strukturellen Ursachen für Hoffnungslosigkeit in den Blick nimmt und aus diesen heraus Transformationsperspektiven entwickelt. Denn erst eine über Gemeineigentum definierte gesellschaftliche Verfügungs- und Entscheidungsmacht schafft die Grundlage für gemeinsame Handlungsräume und schafft damit die materielle Grundlage für hoffnungsvolle Zukunftsgestaltung. Öffentlicher Luxus verändert letztendlich auch den gesellschaftlichen Zukunftsbezug: von einer passiven, im Bewusstsein des Ausgeliefertseins nach bestmöglicher Anpassung strebenden Haltung, die oft in Resignation und Perspektivlosigkeit mündet, hin zu einer aktiven, kollektiv gestaltenden und emanzipatorischen – also einer hoffnungsvollen – Haltung gegenüber der Welt.