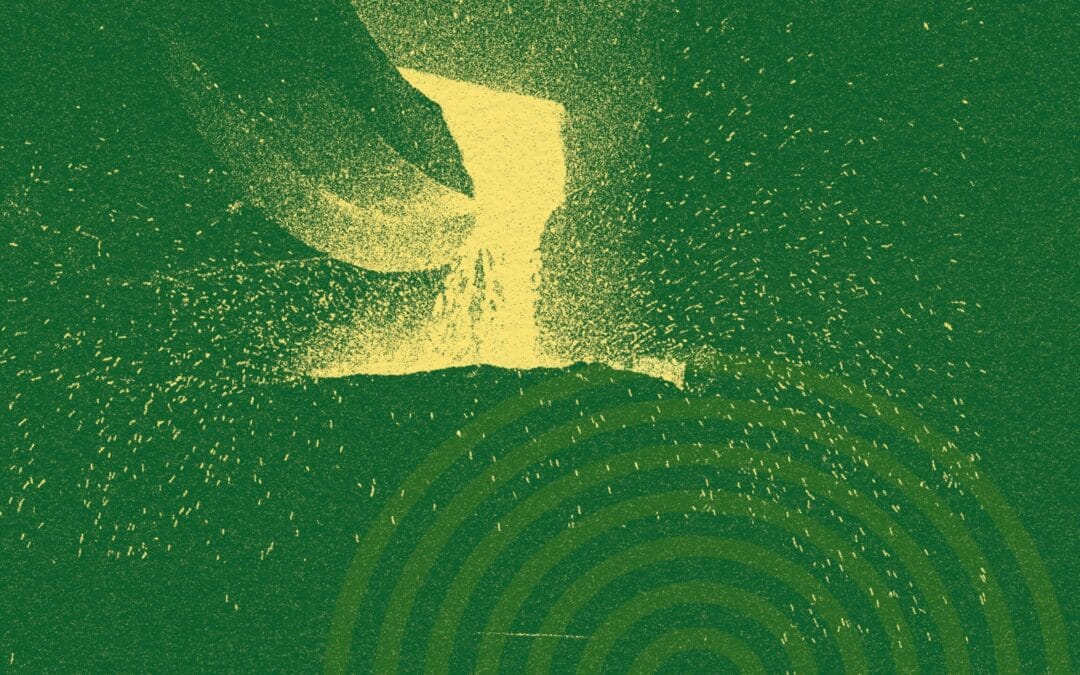Dieser Kommentar von Richard Bärnthaler und Lukas Warning (communia) erschien zuerst im Surplus Magazin.
Zohran Mamdani will die Daseinsvorsorge in New York neu aufstellen. Die Idee von »Öffentlichem Luxus« könnte auch die Politik in Deutschland inspirieren.
In New York schlägt der progressive Bürgermeisterkandidat Zohran Mamdani ein ungewöhnliches, aber viel beachtetes Projekt vor: kommunale Supermärkte. In jedem der fünf Stadtbezirke soll ein städtisch betriebener Laden entstehen – ohne Profitabsicht, mit Produkten zum Großhandelspreis. Ziel ist es, die explodierenden Lebensmittelpreise zu senken, »Food Deserts«, also Gebiete mit eingeschränktem Zugang zu frischen, nährstoffreichen und bezahlbaren Lebensmitteln, zu überwinden und Ernährungssicherheit als öffentliches Gut zu begreifen. Zwei Drittel der New Yorkerinnen und New Yorker unterstützen die Idee – quer durch alle politischen Lager.
Was Mamdani vorschlägt, ist mehr als ein lokales Wahlversprechen. Es ist ein konkretes Beispiel für ein neues Verständnis von Daseinsvorsorge: Universal Basic Services (UBS). UBS steht für die kollektive Bereitstellung grundlegender Güter und Dienstleistungen – von Wohnen über Mobilität bis hin zu Ernährung, Pflege und digitaler Teilhabe. Es geht nicht nur um die Verteidigung ehemals öffentlicher Infrastrukturen, sondern um deren Weiterentwicklung: sozial innovativ, ökologisch tragfähig und demokratisch organisiert.
Dabei kann UBS je nach Kontext ganz unterschiedlich aussehen – vom kostenlosen Zugang zu lokal bezogener Schulverpflegung bis hin zu kostenbasierten, aber nicht gewinnorientierten Mieten im Wohnbau; vom kostenlosem Internetzugang bis hin zu genossenschaftlich organisierten Pflegeplattformen wie der Equal Care Co-op im Vereinigten Königreich; vom kostenlosen öffentlichen Nahverkehr zum Zugang zu Natur – etwa durch wohnortnahe Naherholungsgebiete oder ein erweitertes »Right to Roam«.
Entscheidend ist die Idee dahinter: Was wir zum Leben brauchen, soll nicht länger künstlich verknappt und dem Markt überlassen bleiben, sondern als soziales Recht garantiert werden – unabhängig vom Geldbeutel oder Aufenthaltstitel. UBS ist damit mehr als Krisenbewältigung. Es ist ein Zukunftsversprechen: eine Zukunft, die nicht nur weniger schlimm ist, sondern besser. Ein Narrativ des öffentlichen Luxus, das Hoffnung macht.
Warum öffentlicher Luxus?
Der Begriff »öffentlicher Luxus« ist eine bewusste Provokation. Er stellt sich gegen die neoliberale Erzählung, dass das Öffentliche immer nur Mangelverwaltung sei. Stattdessen geht es um hochwertige, zugängliche und demokratisch kontrollierte Infrastrukturen, die das Leben besser machen – nicht nur für sozioökonomisch schwache Gruppen, sondern für die breite Mehrheit. Öffentlicher Luxus bedeutet: kostenloser Nahverkehr und Kinderbetreuung, wohnortnahe Gesundheitszentren, kommunale Supermärkte mit fairen Preisen, digitale Grundversorgung für alle, Räume für Erholung, Bildung und Kultur.
Diese Vision ist nicht utopisch. Sie ist machbar – und notwendig. Denn die Realität ist: Immer mehr Menschen geben einen Großteil ihres Einkommens für Grundbedürfnisse aus. Gleichzeitig werden diese Bedürfnisse oft durch private Anbieter gedeckt, deren Ziel nicht Versorgung, sondern Profit ist. Die Folge: steigende Preise, sinkende Qualität, wachsende Unsicherheit. UBS kehrt diese Logik um. Es geht nicht um Almosen, sondern um kollektive Aneignung des gesellschaftlichen Reichtums.
Universal Basic Services statt Bedingungslosem Grundeinkommen: Drei Gründe
UBS wurde ursprünglich als Gegenentwurf zum Bedingungslosen Grundeinkommen (BGE) entwickelt, dessen Ziel es ist, allen Bürgerinnen und Bürgern regelmäßig einen festen Geldbetrag auszuzahlen – unabhängig von Bedürftigkeit oder Erwerbstätigkeit. In der Debatte um sozial-ökologische Transformation gelten diese Ansätze oft als Alternativen: Beide wollen Sicherheit schaffen und Ungleichheit abbauen. Doch in drei zentralen Punkten ist UBS dem BGE überlegen.
1. Effektivere Umverteilung
Sowohl das BGE als auch UBS können über progressive Steuern finanziert werden – sofern man der keineswegs unumstrittenen Annahme folgen möchte, dass staatliche Ausgaben grundsätzlich durch Steuereinnahmen gedeckt sein müssen. Beide Modelle entfalten dadurch eine gewisse Umverteilungswirkung, indem sie höhere Einkommen stärker belasten und die Mittel entweder in Form von Geldleistungen (BGE) oder öffentlichen Infrastrukturen und Dienstleistungen (UBS) allen zugänglich gemacht werden. Doch UBS geht einen entscheidenden Schritt weiter: Es wirkt auch auf der Ausgabenseite. Wer wenig verdient, gibt anteilig mehr für Wohnen, Energie oder Mobilität aus. Wenn diese Leistungen kollektiv bereitgestellt werden, profitieren gerade diese Haushalte besonders stark. UBS ist damit strukturell gerechter.
2. Höhere ökologische Wirksamkeit und gestärkte geopolitische Souveränität
Kollektive Infrastrukturen sind nicht nur sozial gerechter, sondern auch ökologisch effizienter. Studien zeigen: Öffentliche Leistungen gehen mit höherer Bedürfnisbefriedigung und gleichzeitig geringerem Energieverbrauch einher. Der öffentliche Verkehr spart Emissionen, gemeinschaftlich genutzte Gebäude reduzieren Energieverbrauch, und öffentliche Wasserversorgungssysteme – wie im Beispiel Eau de Paris – reduzieren Umweltbelastungen. Ein höheres Maß an kollektiver Bereitstellung ermöglicht vergleichbares oder sogar besseres Wohlbefinden bei geringerem Ressourcenaufwand. Entscheidend ist: Nicht Einkommenszuwächse oder individueller Konsum steigern vorrangig das Wohlbefinden, sondern der Zugang zu gemeinsam genutzten, hochwertigen Infrastrukturen.
UBS ermöglicht so eine strukturelle Neuausrichtung des Konsums – nicht durch Verzicht, sondern durch geteilte Qualität. Es geht um kollektiven Konsum über kollektive Infrastrukturen, die allen zugutekommen.
UBS adressiert dabei nicht nur die ökologische Krise, sondern auch Fragen strategischer Autonomie: Weniger Ressourcenverbrauch durch kollektive Bereitstellung bedeutet auch weniger Abhängigkeit von globalen Lieferketten, weniger geopolitische Verwundbarkeit und mehr Versorgungssicherheit. Etwa durch mehr öffentlichen Verkehr statt Subventionierung des motorisierten Individualverkehrs, durch geringeren Energiebedarf beim Wohnen, oder durch geringeren Wasserverlust und weniger Bedarf an chemischen Zusatzstoffen dank öffentlicher Wasserversorgungssysteme mit lokalem Quellschutz.
3. Systemischer Wandel statt Symptombehandlung
Das BGE betrachtet politökonomische Probleme oft als Fragen von Einkommen und Kaufkraft – und übersieht dabei, dass es letztlich um den Zugang zu konkreten Gütern und Dienstleistungen geht. Ein monatlicher Geldbetrag allein garantiert keinen Platz in einer leistbaren Wohnung, keinen Termin in einer öffentlichen Arztpraxis und kein funktionierendes Nahverkehrssystem. Wenn diese Infrastrukturen fehlen – oder weiterhin profitorientiert organisiert sind –, bleibt das Grundeinkommen wirkungslos oder subventioniert lediglich privaten Konsum auf Märkten, anstatt kollektive Alternativen zu stärken.
Es genügt nicht, innerhalb der bestehenden Wirtschaftsordnung Kaufkraft zu generieren oder umzuverteilen, wenn die Wirtschaft selbst – ihre Ziele, Strukturen und Inhalte – grundlegend transformiert werden muss. Genau hier setzt UBS an: Es stellt die Frage nach den Bereitstellungssystemen ins Zentrum. Wer kontrolliert die Infrastruktur? Wer entscheidet, was produziert wird – und für wen? UBS als öffentlicher Luxus zielt auf Demokratisierung, Vergesellschaftung und kollektive Planung. Es ist ein Hebel für echten Strukturwandel.
Transformation braucht Hoffnung – und Konflikt
Die Klimakrise, soziale Spaltung und politische Polarisierung zeigen: Ein »Weiter so« kann keine Option sein. Doch viele Menschen erleben ökologische Maßnahmen als Bedrohung – weil sie teuer, ungerecht verteilt und schlecht kommuniziert sind. Wenn Klimapolitik vor allem mit Verzicht assoziiert wird, ist Widerstand vorprogrammiert. UBS bietet hier eine Alternative: Es verbindet ökologische Notwendigkeit mit sozialer Sicherheit. Es macht Wandel attraktiv.
Gleichzeitig benennt UBS klar, dass dieser Wandel nicht ohne Konflikte zu haben ist. Öffentlicher Luxus ist kein Konsensprojekt. Er fordert eine Umverteilung von Macht und Ressourcen – weg von Konzernen und Superreichen, hin zu demokratisch kontrollierten Gemeingütern. UBS ist damit auch eine Kampfansage: gegen die Privatisierung des Lebens, gegen künstliche Knappheit, gegen die Logik des Profits in der Grundversorgung.
Ein Projekt für die Vielen
Damit UBS mehr ist als ein gutes Konzept, braucht es eine neue politische Erzählung. Die Sprache der Policy Papers reicht nicht. Es braucht ein Narrativ, das begeistert – das Lust auf Zukunft macht und Allianzen schafft. Öffentlicher Luxus kann dieses Narrativ sein: eine Einladung zur Rückeroberung dessen, was uns alle täglich versorgt, zur Demokratisierung der Infrastruktur und zur solidarischen Gestaltung des Alltags.