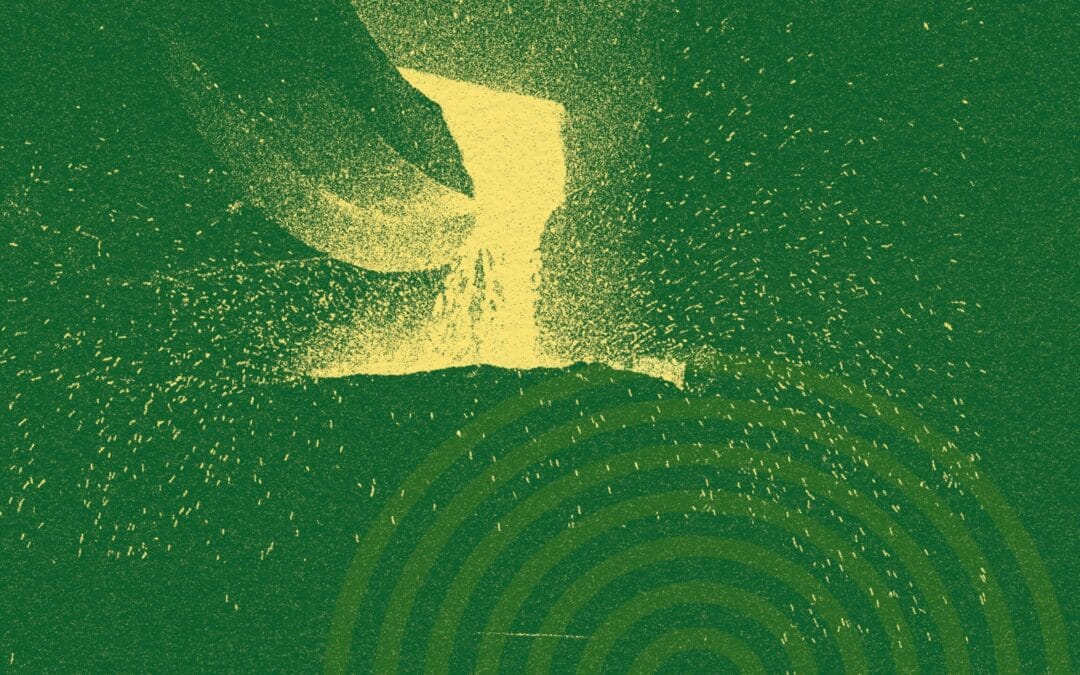Phil Jones vom britischen Autonomy Institute hat einen Text dazu geschrieben, wie sich Öffentlicher Luxus von einem konventionellen Verständnis der Grundversorgung abhebt, dieses ausweitet und bestärkt. Der Text wurde ursprünglich am 01. April 2025 auf dem Blog des Autonomy Institute auf Englisch veröffentlicht und von Vincent auf Deutsch übersetzt.
Einführung
Der Begriff „Universelle Grundversorgung“ (Universal Basic Services, UBS) hat sich zu einer gängigen Bezeichnung für die Vision eines öffentlichen Sektors im einundzwanzigsten Jahrhundert entwickelt, der barrierefrei, für alle zugänglich und kostenlos ist. Der Begriff wurde vor etwa sieben Jahren vom Institute for Global Prosperity (IGP) geprägt, um eine Alternative zum „Universellen Grundeinkommen“ (UBI) in die Debatte einzubringen. Er umfasst sieben Dienstleistungen: Nahrung, Wohnen, Gesundheitsversorgung, Bildung, Rechtsberatung, Verkehr und Internet. Aber worauf läuft dieses Verständnis eigentlich hinaus?
In einem früheren Blogbeitrag, den unser Geschäftsführer Will Stronge vor einigen Jahren für das Autonomy Institute veröffentlicht hat, heißt es dazu:
„…viele dieser Dienstleistungen werden in diesem Bericht nicht als universell vorgeschlagen. Wohnungen sollen zuerst an die Bedürftigsten vergeben werden, was auf einen (lobenswerten) Vorschlag hinausläuft, einfach mehr Häuser zu bauen und kostenlose Versorgungsleistungen bereitzustellen. Der „kostenlose Transport“ ist eigentlich nur eine Erweiterung der kostenlosen Busfahrkarten. UBFood enthält nur wenige logistische Details: Werden wir die Menschen wirklich über ein erweitertes Netz von Lebensmittelbanken und Suppenküchen mit Lebensmitteln versorgen?“
Obwohl ein zentrales Anliegen der UBS darin liegt, eine Logik der Sparsamkeit in unserem politischen Denken zu überkommen, sind die meisten Veröffentlichungen zu diesem Thema von genau dieser Logik geprägt. Sie sind Ausdruck einer Mentalität, die sich nicht mehr traut, gute Dinge zu fordern, und zielt meist darauf ab, die öffentlichen Dienstleistungen wieder auf denselben Standard wie in einer früheren Ära zu bringen.
Ein Bericht der Labour-Partei zu diesem Thema – der 2019, einige Jahre nach dem das IGP-Papier veröffentlicht wurde – formulierte die Idee der UBS als Wiederherstellung der durch die Sparmaßnahmen verlorenen Dienstleistungen. Das ist allerdings auch im Kontext des Ausmaßes der Kürzungen im vorangegangenen Jahrzehnt zu betrachten. In den jüngsten Veröffentlichungen werden die bestehenden Dienstleistungen jedoch eher isoliert betrachtet, was die Frage aufwirft: Wenn wir über UBS sprechen, reden wir dann wirklich nur über die Wiederbelebung des öffentlichen Sektors?
Was meinen wir mit Grundversorgung?
Der Begriff Grundversorgung dürfte kaum Begeisterung hervorrufen: Mit seinen Konnotationen von ‚streng‘, ‚glanzlos‘, ja sogar ‚fadenscheinig‘ löst er zunehmend die Assoziation eines untauglichen öffentlichen Raums aus, der seiner Aufgabe nicht mehr gerecht werden kann. In der Tat hat das Bild eines tristen grauen Monolithen lange Zeit das Bild des britischen Staates dominiert, sogar noch vor dem Schaden, den die jahrzehntelange Austerität angerichtet hat.
Wie Anna Coote und Andrew Percy an anderer Stelle erläutert haben, bedeutet ‚grundlegend‘ hier natürlich nicht grundlegend im abwertenden Sinne, sondern vielmehr die Befriedigung grundlegender Bedürfnisse. Im Zusammenhang mit dem Grundeinkommen macht das Sinn. Ein primäres Ziel des Grundeinkommens ist die Deckung des täglichen Bedarfs mit einer bestimmten Menge an Geld. Der Begriff ‚grundlegend‘ legt jedoch die Messlatte für Dienstleistungen, die sich sowohl durch Qualität als auch durch Quantität definieren, recht niedrig. Natürlich müssen öffentliche Dienstleistungen das Überlebensnotwendige abdecken: Gesundheits- und Sozialfürsorge, Nahrung, Wohnung, Bildung usw. Doch was diese Grundversorgung ausmacht, ist historisch bedingt. In ihrem Buch über UBS stellen Coote und Percy fest, dass „alle Menschen die gleichen Grundbedürfnisse haben“. Dazu gehören auch Gesundheitsversorgung und Bildung.
Das Problem dabei ist: Man kann nicht über ein bestimmtes Maß an Bildung oder Gesundheitsversorgung sprechen, so wie man über Kalorien oder Wasser sprechen kann. Was das Mindestmaß an Gesundheitsversorgung und Bildung ausmacht, ist eine qualitative Frage und hängt ebenso sehr von den gesellschaftlichen Erwartungen wie von einem wesentlichen, unveränderlichen menschlichen Bedürfnis ab. Das Gleiche gilt für Wasser und Nahrung.
Eine kürzlich von IPSOS durchgeführte Umfrage ergab, dass 7 von 10 Personen der Meinung sind, dass die öffentlichen Dienstleistungen ihren Bedürfnissen und Erwartungen nicht gerecht werden. Die Erwartungen waren nicht gerade hoch, wobei die Mehrheit der Teilnehmer:innen die wenig ehrgeizigen Vorschläge für mehr Ressourcen, ausreichend Personal und bessere Koordination anführte. Vor einigen Jahren habe ich argumentiert, dass die Sparmaßnahmen zum Teil ein Projekt sind, das das Selbstwertgefühl der Gesellschaft schwächt, so dass die Öffentlichkeit nicht länger ‚gute Dinge‘ erwartet. Fadenscheinige Mantras über öffentliche Ausgaben wie ‚der magische Geldbaum‘ und ‚kein Geld mehr‘ senken die Erwartungen der Öffentlichkeit in einem solchen Maße, dass wir uns keine bessere Zukunft vorstellen können.
Stellen wir uns also eine ausgefallene Frage: Was wäre, wenn die öffentlichen Dienstleistungen die Erwartungen übertreffen würden? Warum sollten wir nicht versuchen, die öffentlichen Dienstleistungen außergewöhnlich statt akzeptabel zu machen? Was wäre, wenn anstelle von ‚karg‘, ‚baufällig‘, ‚kaputt‘ und ‚unzureichend‘ die Worte ‚reichlich‘, ‚komfortabel‘, ‚elegant‘ und ‚glamourös‘ in den Sinn kämen?
Der Begriff ‚Grundversorgung‘ setzt die Messlatte für Dienstleistungen, die sich sowohl durch Qualität als auch durch Quantität auszeichnen, jedoch recht niedrig an.
Öffentlicher Luxus
Der Begriff ‚öffentlicher Luxus‘ hat sich in den letzten Jahren bei einer Reihe von Wissenschaftlern und Kommentatoren durchgesetzt. Im Zusammenhang mit der öffentlichen Sphäre mag er seltsam anmuten. Schließlich wird Luxus in der Regel als eine Form des auffälligen privaten Konsums betrachtet, in der Regel von Statusgütern wie Markenkleidung oder Dienstleistungen, die nur den Wohlhabenden vorbehalten sind – wie Fünf-Sterne-Boutique-Hotels. In diesem Zusammenhang steht der Begriff für die Idee, dass Dienstleistungen nicht nur einfach funktional sein sollten, sondern jedem den Zugang zum ‚guten Leben‘ ermöglichen. Wenn privater Luxus die wirtschaftliche Realität impliziert, dass ‚für die Superreichen nichts zu teuer ist‘, dann impliziert öffentlicher Luxus stattdessen die utopische Idee, die der US-amerikanische Gewerkschaftsorganisator Bill Heywood ausgedrückt hat, dass ‚nichts zu gut für die Arbeiterklasse ist‘. Er suggeriert einen radikalen Egalitarismus: ‚Alles für alle‘.
Öffentlicher Luxus bedeutet eine Fülle von guten Dingen, Räumen und Erfahrungen, die für alle zugänglich sind. Anstelle von Infinity-Pools für einige wenige bedeutet er reichlich und gut gebaute Strandbäder und Schwimmbäder für viele; anstelle von riesigen eiszeitlichen Wolkenkratzern, die im Namen der Finanzwelt gebaut werden, bedeutet er schöne öffentliche Bauprojekte, die dem Umfang und dem Ehrgeiz des Modernismus des zwanzigsten Jahrhunderts entsprechen. Es bedeutet, dass jede Gemeinde ein Restaurant oder eine Kantine hat, die köstliches, erschwingliches Essen serviert. Es bedeutet großzügige und attraktive Parks, in denen die Menschen gerne Zeit verbringen. Wie Enrique Peñalosa, der ehemalige Bürgermeister von Bogota, vorschlägt, „sollte eine gute Stadt über den grundlegenden öffentlichen Fußgängerbereich hinaus mindestens einen und idealerweise mehrere ‚große‘ öffentliche Räume haben. Das heißt, Räume von solcher Qualität, dass „selbst die wohlhabendsten Mitglieder der Gesellschaft nicht umhinkommen, sie aufzusuchen“.
Die moderne Idee des ‚öffentlichen Luxus‘ geht auf die utopischen Visionen sozialdemokratischer und sozialistischer Regierungen im Europa des frühen zwanzigsten Jahrhunderts zurückgeht. Der Begriff selbst wurde aber erst 2017 vom Guardian-Journalisten George Monbiot in einem Artikel mit dem Titel „Öffentlicher Luxus für alle oder privater Luxus für einige: Das ist die Wahl, vor der wir stehen“ verwendet. Während die meisten Vorschläge zur Grundversorgung für öffentliche Suffizienz plädieren, schlägt Monbiot stattdessen „private Suffizienz und öffentlichen Luxus“ vor. Diese Provokation untergräbt unser übliches Verständnis von privatem und öffentlichem Sektor: Der letztere ist darin durch Prunk und der erstere durch Mäßigung gekennzeichnet.
In der europäischen Geschichte gibt es viele Beispiele für „öffentlichen Luxus“, von außergewöhnlichen Bibliotheken, Stadttheatern und Wohnsiedlungen mit ‚glamourösem‘ Anspruch, bis hin zu reichlich vorhandenen öffentlichen Toiletten und sprudelnden Trinkwasserbrunnen. In den weiteren Blogbeiträgen dieser Serie werden wir einige dieser Beispiele untersuchen. Doch zunächst wollen wir uns auf ein Beispiel aus der Geschichte des Vereinigten Königreichs konzentrieren.
The British Restaurant
Das britische Restaurantprogramm war ein landesweites Netz staatlich subventionierter öffentlicher Speiseräume, das geschaffen wurde, um die ausgebombte und hungernde britische Bevölkerung während des Zweiten Weltkriegs zu versorgen. Es überrascht ein wenig, dass das Programm von Premierminister Winston Churchill ins Leben gerufen wurde. Churchill, ein bekannter Feinschmecker, wollte mit seinem unbeirrbaren Nationalismus die Kriegsanstrengungen der anderen europäischen Nationen in den Schatten stellen. Er bestand in diesem Zuge darauf, dass in den Restaurants nur Gourmetgerichte serviert werden sollten – auch wenn dies aus finanziellen Gründen politisch nicht möglich war. Dennoch wurden die Mahlzeiten nicht von einer Logik der Sparsamkeit diktiert, sondern enthielten nach allem, was man hört, köstliche und nahrhafte Speisen.
Das Projekt war nicht von der Logik der Sparsamkeit motiviert. Es bestand die dringende Notwendigkeit, die Bevölkerung zu verpflegen. Das aber dem Bestreben keinen Abbruch, den Küchen einen kulturellen und ästhetischen Wert zu verleihen.
In der paternalistischen Art, die später im Mittelpunkt des Nachkriegskonsenses stehen sollte, wurden viele britische Restaurants mit in Auftrag gegebenen Kunstwerken und ansprechender Dekoration geschmückt, die von Churchills Regierung eigenhändig beschlossen wurde. Einige verfügten sogar über Wandgemälde, die von lokalen Künstlern gemalt wurden, über Bibliotheken und frische Blumen auf den Tischen sowie über Klaviere und Grammophone, die von den Gästen benutzt werden konnten.
Der Luxus des zwanzigsten Jahrhunderts beruhte oft auf imperialistischer Ausbeutung. Churchills Nationalismus bedeutete, dass er bereit war, Millionen von Indern während der Hungersnot in Bengalen verhungern zu lassen, während er weiterhin Reis vom Subkontinent für die Puddings in den britischen Gemeinschaftsrestaurants importierte. Eine zeitgemäße Vision des gemeinschaftlichen Essens muss sich ernsthaft mit dem Problem der kapitalistischen Lieferketten auseinandersetzen und gleichzeitig Beziehungen zu ethischen und nachhaltigen Betrieben im In- und Ausland pflegen. Es müsste eine Rolle bei der Umstrukturierung des britischen Lebensmittelsystems als Ganzes spielen, anstatt nur den öffentlich sichtbaren Teil eines ausbeuterischen Systems zu repräsentieren.
Nichtsdestotrotz hilft uns das britische Restaurant, für eine Politik zu argumentieren, deren Zeit wieder gekommen ist. Die Idee staatlich subventionierter Restaurants, die anständiges Essen zu erschwinglichen Preisen anbieten, ist keine Utopie, sondern eine historische Realität, die jeden Kritiker Lügen straft, der glaubt, eine solche Idee sei reine Fantasie. Der Ehrgeiz und der Umfang des Projekts – es erstreckt sich über das gesamte Vereinigte Königreich – zeigen, dass ein universeller Ansatz in Krisenzeiten logistisch und finanziell machbar ist. Vielleicht noch wichtiger ist, dass es uns hilft, uns vorzustellen, wie ein Gemeinschaftsrestaurant des einundzwanzigsten Jahrhunderts aussehen könnte. In einem späteren Blog-Beitrag dieser Reihe werden wir uns ein modernes Gemeinschaftsrestaurant genauer vorstellen.