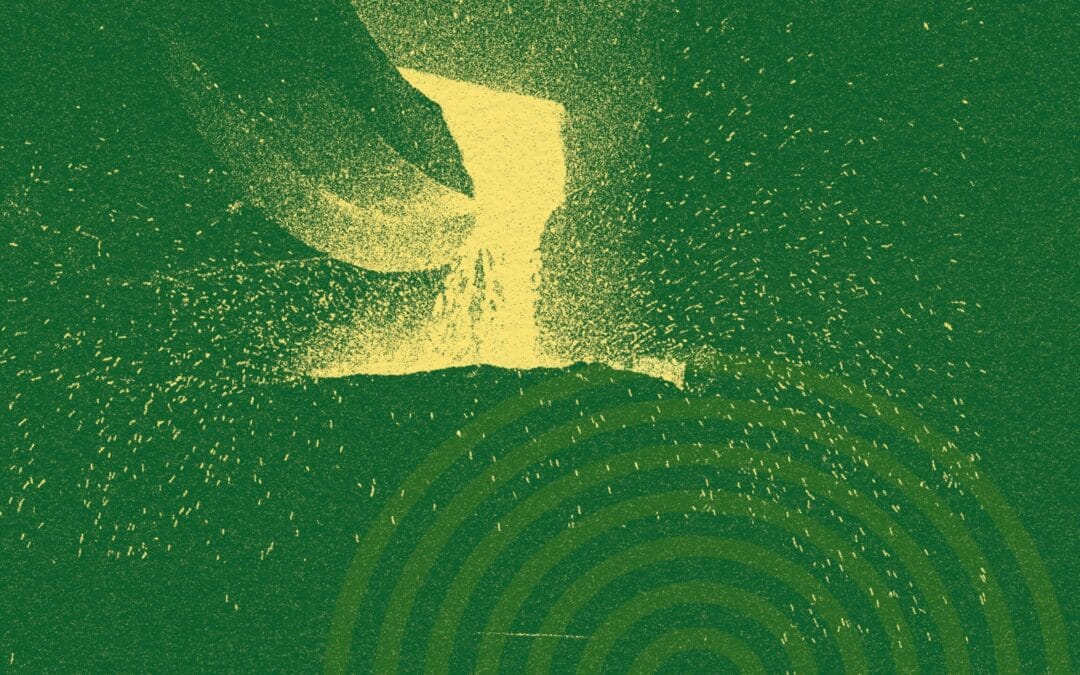Gastbeitrag von Annika Fuchs, ROBIN WOOD Mobilitätsreferentin.
Kleinbusse statt Militärfahrzeuge – dafür stehen gerade immer mehr Menschen ein, die sich in der „Friedensstadt“ Osnabrück und darüber hinaus zusammentun. Sie fordern, dass das VW-Werk in Osnabrück mit 2300 Beschäftigten Ende 2027 nicht an Rheinmetall verkauft, sondern für die Produktion öffentlicher Verkehrsmittel wie Busse oder Bahnen umgenutzt wird. Und sie fordern eine Demokratisierung dieses Entscheidungsprozesses.
Doch wie kam es dazu, dass sich diese Fragen überhaupt stellen?
Am 13. März 2025 titelt die Neue Osnabrücker Zeitung: „Militärfahrzeuge aus der Friedensstadt? VW-Standort Osnabrück laut Rheinmetall für Produktion geeignet“. Das Volkswagenwerk in Osnabrück produziert seit 2011 unterschiedliche Modelle, zuletzt einen VW-Cabrio und Porsche-Sportwagen. Aber auch der MOIA-Kleinbus wurde hier entwickelt und in kleiner Stückzahl hergestellt. Im Rahmen der Krise bei Volkswagen, die sich im Winter 2024 zuspitzte, änderte sich das Klima in der Stadt des westfälischen Friedens. Den 2300 Mitarbeitenden wurde mitgeteilt, dass die Produktion durch VW nur noch bis Ende 2027 weitergeführt wird.
Beinahe im selben Atemzug trat ein neuer Player aufs Spielfeld: Rheinmetall-Chef Papperger besuchte im Frühjahr 2025 das Werk und befand es als grundsätzlich geeignet für die Herstellung von Militärfahrzeugen. Diese Übernahmepläne kommen damit erst einmal nicht überraschend, denn seit der so genannten „Zeitenwende“ der Bundesregierung, die massive Investitionen in die Rüstung, unter anderem durch eine Aussetzung der Schuldenbremse, möglich machte, schießen die Aktienkurse von Rheinmetall in die Höhe. Doch nicht nur Rheinmetall, auch andere Rüstungsunternehmen wie KNDS übernehmen vormalig zivile Werke, und zivile Unternehmen wie die Deutz AG stellen um auf Rüstungsproduktion, denn diese Branche verspricht durch die staatlichen Investitionen langfristige Aufträge und damit gesicherte Gewinne.
Widerstand formiert sich
Als wir von ROBIN WOOD auf diese Neuigkeiten für das Werk in Osnabrück stießen, entschieden wir uns, diese Entwicklungen nicht unkommentiert zu lassen. Wie kann es sein, dass das Projekt Verkehrswendestadt Wolfsburg noch ein, zwei Jahre zuvor für eine Konversion des größten Autowerks Europas eintrat und dabei offensiv eine Umstellung der Produktion hin zu Straßenbahnen forderte, und wir nun vor einer veränderten Situation stehen, in der die Konversion in die falsche Richtung in rasender Geschwindigkeit passiert, direkt vor unseren Augen?
Wir wollten anknüpfen an Konversionskämpfe der Vergangenheit, von Lucas Aerospace über das GKN-Werk in Florenz, in dem Menschen seit 2021 für eine sozial-ökologische Konversion ihres Arbeitsplatzes eintreten, bis hin zur eben genannten Verkehrswendestadt Wolfsburg. Also seilten sich ROBIN WOOD-Aktive vor dem Werk ab. Auf ihrem Banner stand: „ÖPNV statt Panzer – Jobs nicht auf Krieg aufbauen.“
Gleichzeitig und in Folge dessen entstanden neue Verbindungen und ein Austausch zwischen unterschiedlichen Akteur*innen, ein regionales Netzwerk sowie überregionale Kontakte. Kreative Aktionen werden geplant und neue Bündnisse geschmiedet.
Osnabrück als Kristallisationspunkt
Das VW-Werk im Osnabrücker Stadtteil Fledder ist gerade dabei, ein Kristalliationspunkt zu werden. Denn es zieht unterschiedliche politische Strömungen an, die hier in der Friedensstadt einen gemeinsamen Nenner finden.
Friedensbewegte und Antimilitarist*innen werden Teil der Kampagne, weil sie hier im Konkreten gegen die fortschreitende Aufrüstung vorgehen können. Neben Rheinmetall kann auch die Zivilgesellschaft unter dem Stichwort der „Friedensstadt“ adressiert werden, denn in Osnabrück wird dieser Titel mit Stolz getragen.
Die Klima- und Mobilitätswendebewegung kann insofern anknüpfen, als dass bereits begonnene Konversionskämpfe und Ideen weiter entwickelt werden können, wofür das Werk zukünftig genutzt werden könnte. Aus dieser Perspektive ist klar: So dramatisch die Krise der Automobilindustrie für die Beschäftigten ist, so sehr ermöglicht sie ein industriepolitisches Umdenken. Die „deutsche Leitindustrie Automobilität“ kann die Produktion von Gütern voranbringen, die beitragen zu einer sozial-ökologischen Transformation.
Und auch Beschäftigte treibt die Frage um, wie es mit ihrer Zukunft weitergehen wird. Gerade für linke Gruppierungen des Arbeitnehmer*innenumfelds liegt auf der Hand: Wenn nun sowieso ein Umbruch ansteht, ist es Zeit, auch die Demokratisierung der Wirtschaft anzugehen.
Von der Konversion zur Vergesellschaftung
Die Zukunft von VW in Osnabrück schlägt eine Brücke zwischen verschiedenen politischen Spektren von Klimaschutz über Friedenspolitik bis hin zu Gewerkschaften und transformativer Industriepolitik.
Denn natürlich stehen die Forderungen, dass VW das Werk nicht an Rheinmetall verkauft, neben der Notwendigkeit, die Arbeitsplätze vor Ort zu erhalten. Als das Werk vor 2011 noch zu Karmann gehörte, waren am Standort mal über 10.000 Menschen beschäftigt – die Perspektive muss also eher ein Arbeitsplatzausbau statt die Schließung des Werks sein. Doch wer wird dieses Werk übernehmen, wenn VW es nicht weiterführen will und Rheinmetall nicht übernehmen soll?
Hier kann eine Vergesellschaftungsperspektive ansetzen. Momentan sprechen die Beschäftigten in Osnabrück häufig davon, dass die Zukunft des Werks nicht bei ihnen, sondern in der Konzernzentrale in Wolfsburg entschieden wird. Wir sollten jedoch anfangen zu überlegen, wie die Handlungsmacht der Stadt Osnabrück, der Beschäftigten, des Landes Niedersachsen und der Zivilgesellschaft gestärkt werden kann. 2011 kostete das Werk knapp 40 Millionen Euro. Würde die Stadt Osnabrück das Werk kaufen und eine Anstalt öffentlichen Rechts gründen, könnten Beschäftigte gemeinsam mit der Stadtgesellschaft darüber beraten, was vor Ort produziert wird.
Diese Perspektive mag utopisch klingen und ist doch nur ein Zwischenschritt. Denn Vergesellschaftung nach Artikel 15 auf Landesebene, also beispielsweise die Vergesellschaftung des VW-Konzerns durch das Land Niedersachsen, müssen eigentlich unser Anspruch sein, wenn wir tatsächlich eine Demokratisierung der Wirtschaft voran treiben wollen. Dafür ist es wichtig, Positivbeispiele auf lokaler Ebene zu erkämpfen und zu zeigen, dass Menschen mitgestalten wollen bei der Frage, was produziert wird.
In Osnabrück, Bielefeld, Münster, Bremen und Berlin gibt es bereits Menschen, die an dem Thema arbeiten. Wissenschaftler*innen planen, Machbarkeitsstudien zu erstellen, um zu prüfen, was vor Ort tatsächlich produziert und wie auch eine Nachfrage für diese Produkte sichergestellt werden kann. Gewerkschaftler*innen strecken ihre Fühler aus, um Unterstützer*innen im Werk zu finden und Menschen aus Zivilgesellschaft und Politik beraten, wie der Druck auf kommunaler und landespolitischer Ebene erhöht werden kann.
Du möchtest dabei sein? Dann melde dich gern bei annika.fuchs@robinwood.de.
Hier gibt es weitere Infos zur Kampagne: http://robinwood.de/oeffis-statt-panzer/